Drehbuch: A. Scott Berg, John Logan, A. Scott Berg
Schauspieler*innen: Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman, Laura Linney
Kinostart D: (FSK 6)
Kinostart US: (FSK PG-13)
Originaltitel: Genius
Laufzeit: 1:44 Stunden
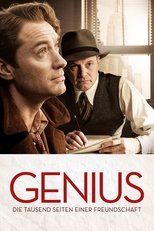
Filmkritik zu Genius – Die tausend Seiten einer Freundschaft
Das New York der 1920er – jeder Mann trägt Hut. Einer ganz besonders: Lektor Maxwell Perkins (Colin Firth), seines Zeichens Lektor von seinerzeit noch unbekannten Autoren wie Hemingway oder Fitzgerald. Stets ruhig, stets bedacht, kaum emotional. Selbst zu Hause trägt er Hut.
Perkins trifft auf Thomas Wolfe (Jude Law), einem Autoren, der mit zuerst 1.000, später 5.000 Seiten als Buch erscheint und voller Euphorie und Kreativität förmlich übersprudelt.
Beide verbindet eine tiefe Freundschaft.
Der Film, based on a true story, erzählt eine Geschichte von der Freundschaft von zwei gegensätzlichen Charakteren. Es ist eine hoch kreative Hassliebe: Mehr als einmal formuliert Wolfe, dass jedes Wort aus seiner Seele käme, während Perkins seine Entwürfe gnadenlos zusammenstreicht. Mit Erfolg: Die Werke Wolfes verkaufen sich hervorragend.
Anfangs erscheint Wolfe zu überbordend, zu wild, zu kreativ, zu unruhig. Er bleibt es den gesamten Film. Doch bald merkt man, dass die klug gesetzten Impulse Perkins und die Kreativität Wolfes eine Eigendynamik entwickeln, die Bücher zum Erfolg werden lässt. Das Spannungsfeld ist nicht besonders mitreissend, dennoch durchaus interessant zu verfolgen.
Der Sog der Zusammenarbeit allein ist schon durchaus sehenswert. Doch Fahrt nimmt der Film besonders auf, wenn die Frauen der beiden kreativen Köpfe die Ekstase der Männer nicht mehr tragen wollen. Insbesondere die Frau von Wolfe, gespielt von Nicole Kidman, verliert jegliche Zuversicht in ihren Geliebten. Parallel verfällt Wolfe dem Größenwahnsinn und jeglicher Erfolg, jegliche Zusammenarbeit scheint an der Arroganz von ihm zu scheitern.
Das Schauspiel aller wichtigen Darsteller ist perfekt, das Szenenbild des New Yorks der 1920er gut eingefangen. Handwerklich gibt es am Film nichts auszusetzen.
Dennoch gelingt nie der wahre Kontakt zu den beiden Protagonisten. Perkins ist zu nüchtern, zu sachlich, um mit ihm zu sympathisieren. Wolfe ist das Gegenteil: So von Emotionen und Erfolg überbordend, wirkt er wie ein wilder Paradiesvogel, der in seiner ganz eigenen Welt ohne Kontakt zum Zuschauer lebt. Die Symbiose wird eindeutig sichtbar, doch ein Mitfühlen oder gar -fiebern bleibt aus.
Erst am Ende kommen Emotionen durch, Perkins wird menschlich, Wolfe selbsteinsichtig. Das Ende kommt hart, jedoch passend. Es stimmt versöhnlich.
Ach, und was den Hut betrifft: Einmal nimmt ihn Perkins ab. Symbolisch in einer der emotionalsten Szenen. Das ist aber der einzige Fauxpas der plakativen Darstellung.
